Goethes Naturwissenschaftliche Schriften
GA 1
10. Wissen und Handeln im Lichte der Goetheschen Denkweise
1. Methodologie
[ 1 ] Wir haben das Verhältnis von der durch das wissenschaftliche Denken gewonnenen Ideenwelt und der unmittelbar gegebenen Erfahrung festgestellt. Wir haben Anfang und Ende eines Prozesses kennen gelernt: Ideenentblößte Erfahrung und ideenerfüllte Wirklichkeitsauffassung. Zwischen beiden liegt aber menschliche Tätigkeit. Der Mensch hat tätig das Ende aus dem Anfang hervorgehen zu lassen. Die Art, wie er das tut, ist die Methode. Es ist nun selbstverständlich, daß unsere Auffassung jenes Verhältnisses von Anfang und Ende der Wissenschaft auch eine eigentümliche Methode bedingen wird. Wovon werden wir bei Entwicklung derselben auszugehen haben? Das wissenschaftliche Denken muß sich Schritt für Schritt als ein Überwinden jener dunklen Wirklichkeitsform ergeben, die wir als unmittelbar Gegebenes bezeichnet haben, und ein Heraufheben desselben in die lichte Klarheit der Idee. Die Methode wird also darinnen bestehen müssen, daß wir bei jeglichem Dinge die Frage beantworten: Welchen Anteil hat es für die einheitliche Ideenwelt; welche Stelle nimmt es in dem ideellen Bilde ein, das ich mir von der Welt mache? Wenn ich das eingesehen habe, wenn ich erkannt habe, wie ein Ding sich an meine Ideen anschließt, dann ist mein Erkenntnisbedürfnis befriedigt. Für das letztere gibt es nur ein Nichtbefriedigendes: wenn mir ein Ding gegenübertritt, das sich nirgends an die von mir vertretene Anschauung anschließen will. Das ideelle Unbehagen muß überwunden werden, das daraus fließt, daß es irgend etwas gibt, von dem ich mir sagen müßte: ich sehe, es ist da; wenn ich ihm gegenübertrete, sieht es mich wie ein Fragezeichen an; aber ich finde nirgends in der Harmonie meiner Gedanken den Punkt, wo ich es einreihen könnte; die Fragen, die ich in Ansehung seiner stellen muß, bleiben unbeantwortet; ich mag mein Gedankensystem drehen und wenden, wie ich will. Daraus ersehen wir, wessen wir in Ansehung eines jeden Dinges bedürfen. Wenn ich ihm gegenübertrete, starrt es mich als einzelnes an. In mir drängt die Gedankenwelt jenem Punkte zu, wo der Begriff des Dinges liegt. Ich ruhe nicht eher, bis das, was mir zuerst als einzelnes gegenübergetreten ist, als Glied innerhalb der Gedankenwelt erscheint. So löst sich das einzelne als solches auf und erscheint in einem großen Zusammenhange. Jetzt ist es von der andern Gedankenmasse beleuchtet, jetzt ist es dienendes Glied; und es ist mir völlig klar, was es innerhalb der großen Harmonie zu bedeuten hat. Das geht in uns vor, wenn wir einem Gegenstande der Erfahrung betrachtend gegenübertreten. Aller Fortschritt der Wissenschaft beruht auf dem Gewahrwerden des Punktes, wo sich irgend eine Erscheinung in die Harmonie der Gedankenwelt eingliedern läßt. Man darf das nicht mißverstehen. Es kann nicht so gemeint sein, als wenn jede Erscheinung durch die hergebrachten Begriffe erklärbar sein müsse; als ob unsere Ideenwelt abgeschlossen wäre und alles neu zu erfahrende sich mit irgendeinem Begriffe, den wir schon besitzen, decken müsse. Jenes Drängen der Gedankenwelt kann auch zu einem Punkte hingehen, der bisher überhaupt noch von keinem Menschen gedacht worden ist. Und das ideelle Fortschreiten der Geschichte der Wissenschaft beruht gerade darauf, daß das Denken neue Ideengebilde an die Oberfläche wirft. Jedes solche Gedankengebilde hängt mit tausend Fäden mit allen andern möglichen Gedanken zusammen. Mit diesem Begriffe in dieser, mit einem andern in einer andern Weise. Und darinnen besteht die wissenschaftliche Methode, daß wir den Begriff einer einzelnen Erscheinung in seinem Zusammenhange mit der übrigen ldeenwelt aufzeigen. Wir nennen diesen Vorgang: Ableiten (Beweisen) des Begriffes. Alles wissenschaftliche Denken besteht aber nur darinnen, daß wir die bestehenden Übergänge von Begriff zu Begriff finden, besteht in dem Hervorgehenlassen eines Begriffes aus dem andern. Hin- und Herbewegung unseres Denkens von Begriff zu Begriff, das ist wissenschaftliche Methode. Man wird sagen, das sei ja die alte Geschichte von der Korrespondenz von Begriffswelt und Erfahrungswelt. Wir müßten voraussetzen, daß die Welt außer uns (das Transsubjektive) unserer Begriffswelt korrespondiere, wenn wir glauben sollen, daß das Hin- und Hergehen von Begriff zu Begriff zu einem Bilde der Wirklichkeit führe. Das ist aber nur eine verfehlte Auffassung des Verhältnisses von Einzelgebilde und Begriff. Wenn ich einem Gebilde der Erfahrungswelt gegenübertrete, so weiß ich überhaupt gar nicht, was es ist. Erst, wenn ich es überwunden, wenn mir sein Begriff aufgeleuchtet hat, dann weiß ich, was ich vor mir habe. Das will doch aber nicht sagen, daß jenes Einzelgebilde und der Begriff zwei verschiedene Dinge sind. Nein, sie sind dasselbe; und was mir im besonderen gegenübertritt, ist nichts als der Begriff. Der Grund, warum ich jenes Gebilde als abgesondertes, von der andern Wirklichkeit getrenntes Stück sehe, ist eben der, daß ich es seiner Wesenheit nach noch nicht erkenne, daß es mir noch nicht als das entgegentritt, was es ist. Daraus ergibt sich das Mittel, unsere wissenschaftliche Methode weiter zu charakterisieren. Jedes einzelne Wirklichkeitsgebilde repräsentiert innerhalb des Gedankensystems einen bestimmten Inhalt. Es ist in der Allheit der Ideenwelt begründet und kann nur im Zusammenhange mit ihr begriffen werden. So muß notwendig jedes Ding zu einer doppelten Denkarbeit auffordern. Zuerst ist der Gedanke in scharfen Konturen festzustellen, der ihm entspricht, und hernach sind alle Fäden festzustellen, die von diesem Gedanken zur Gesamt-Gedankenwelt führen. Klarheit im einzelnen und Tiefe im ganzen sind die zwei bedeutendsten Erfordernisse der Wirklichkeit. Jene ist Sache des Verstandes, diese Sache der Vernunft. Der Verstand schafft Gedankengebilde für die einzelnen Dinge der Wirklichkeit. Er entspricht seiner Aufgabe um so mehr, je genauer er dieselben umgrenzt, je schärfere Konturen er zieht. Die Vernunft hat dann diese Gebilde in die Harmonie der gesamten Ideenwelt einzureihen. Das setzt natürlich folgendes voraus: In dem Inhalte der Gedankengebilde, die der Verstand schafft, ist jene Einheit schon, lebt schon ein und dasselbe Leben; nur hält der Verstand alles künstlich auseinander. Die Vernunft hebt, ohne die Klarheit zu verwischen, nur die Trennung wieder auf. Der Verstand entfernt uns von der Wirklichkeit, die Vernunft führt uns auf sie wieder zurück. Graphisch wird sich das so darstellen:
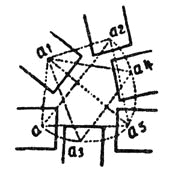
[ 2 ] In dem umstehenden Gebilde hängt alles zusammen; es lebt in allen Teilen dasselbe Prinzip. Der Verstand schafft die Trennung der einzelnen Gebilde, weil sie uns ja in dem Gegebenen als einzelne gegenübertreten, 91Diese Trennung ist durch die absondernden ganz ausgezogenen Linien charakterisiert. und die Vernunft erkennt die Einheitlichkeit. 92Dieselbe ist durch die punktierten Linien versinnlicht.
[ 3 ] Wenn wir folgende zwei Wahrnehmungen haben: 1. die einfallenden Sonnenstrahlen und 2. einen erwärmten Stein, so hält der Verstand die beiden Dinge auseinander, weil sie uns als zwei gegenübertreten; er hält das eine als Ursache, das andere als Wirkung fest; dann tritt die Vernunft hinzu, reißt die Scheidewand nieder und erkennt die Einheit in der Zweiheit. Alle Begriffe, die der Verstand schafft: Ursache und Wirkung, Substanz und Eigenschaft, Leib und Seele, Idee und Wirklichkeit, Gott und Welt usw. sind nur da, um die einheitliche Wirklichkeit künstlich auseinanderzuhalten; und die Vernunft hat, ohne den damit geschaffenen Inhalt zu verwischen, ohne die Klarheit des Verstandes mystisch zu verdunkeln, in der Vielheit die innere Einheit aufzusuchen. Sie kommt damit auf das zurück, wovon sich der Verstand entfernt hat, auf die einheitliche Wirklichkeit. Will man eine genaue Nomenklatur haben, so nenne man die Verstandsgebilde Begriffe, die Vernunftschöpfungen Ideen. Und man sieht, daß der Weg der Wissenschaft ist: sich durch den Begriff zur Idee zu erheben. Und hier ist der Ort, wo sich uns in der klarsten Weise das subjektive und das objektive Element unseres Erkennens auseinanderlegen. Es ist ersichtlich, daß die Trennung nur subjektiven Bestand hat, nur durch unsern Verstand geschaffen ist. Es kann mich nicht hindern, daß ich ein und dieselbe objektive Einheit in Gedankengebilde zerlege, die von denen meines Mitmenschen verschieden sind; das hindert nicht, daß meine Vernunft in der Verbindung wieder zu derselben objektiven Einheit gelangt, von der wir ja beide ausgegangen sind. Das einheitliche Wirklichkeitsgebilde sei sinnbildlich dargestellt [Figur 1]. Ich trenne es verstandesgemäß so, wie Fig. 2; ein anderer anders, wie Fig. 3. Wir fassen
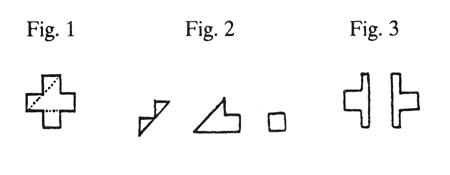
[ 4 ] es vernunftgemäß zusammen und erhalten dasselbe Gebilde. Damit wird es uns erklärlich, wie die Menschen so verschiedene Begriffe, so verschiedene Anschauungen von der Wirklichkeit haben können, trotzdem diese doch nur eine sein kann. Die Verschiedenheit liegt in der Verschiedenheit unserer Verstandeswelten. Damit verbreitet sich für uns ein Licht über die Entwicklung verschiedener wissenschaftlicher Standpunkte. Wir begreifen, woher die vielfachen philosophischen Standpunkte kommen, und haben nicht nötig, ausschließlich einer die Palme der Wahrheit zuzuerkennen. Wir wissen auch, welchen Standpunkt wir selbst gegenüber der Vielheit menschlicher Anschauungen einzunehmen haben. Wir werden nicht ausschließlich fragen: Was ist wahr, was ist falsch? Wir werden immer untersuchen, in welcher Art die Verstandeswelt eines Denkers aus der Weltharmonie hervorgeht; wir werden zu begreifen suchen und nicht aburteilen und sogleich als Irrtum ansehen, was mit der eigenen Auffassung nicht übereinstimmt. Zu diesem Quell der Verschiedenheit unserer wissenschaftlichen Standpunkte tritt dadurch ein neuer, daß jeder einzelne Mensch ein anderes Erfahrungsfeld hat. Es tritt ja jedem aus der gesamten Wirklichkeit gleichsam ein Ausschnitt gegenüber. Diesen bearbeitet sein Verstand, und der ist ihm der Vermittler auf dem Wege zur Idee. Wenn wir also auch alle dieselbe Idee wahrnehmen, so ist das doch immer auf andern Gebieten der Fall. Es kann also nur das Endresultat, zu dem wir kommen, dasselbe sein; die Wege hingegen können verschieden sein. Es kommt überhaupt gar nicht darauf an, daß die einzelnen Urteile und Begriffe, aus denen sich unser Wissen zusammensetzt, übereinstimmen, sondern nur darauf, daß sie uns zuletzt dahin führen, daß wir in dem Fahrwasser der Idee schwimmen. Und in diesem Fahrwasser müssen sich zuletzt alle Menschen treffen, wenn sie energisches Denken über ihren Sonderstandpunkt hinausführt. Es kann ja möglich sein, daß uns eine beschränkte Erfahrung oder ein unproduktiver Geist zu einer einseitigen, unvollständigen Ansicht führt; aber selbst die geringste Summe dessen, was wir erfahren, muß uns zuletzt zur Idee führen; denn zur letzteren erheben wir uns nicht durch eine mehr oder weniger große Erfahrung, sondern allein durch unsere Fähigkeiten als menschliche Persönlichkeit. Eine beschränkte Erfahrung kann nur zur Folge haben, daß wir die Idee in einseitiger Weise aussprechen, daß wir über geringe Mittel verfügen, das Licht, das in uns leuchtet, zum Ausdruck zu bringen; sie kann uns aber nicht überhaupt hindern, jenes Licht in uns aufgehen zu lassen. Ob unsere wissenschaftliche oder überhaupt Weltansicht auch vollständig sei, das ist neben der nach ihrer geistigen Tiefe eine ganz andere Frage. Wenn man nun an Goethe wieder herantritt, so wird man viele seiner Darlegungen, mit unseren Ausführungen in diesem Kapitel zusammengehalten, als einfache Konsequenzen der letzteren erkennen. Dieses Verhältnis halten wir für das einzig richtige zwischen Autor und Ausleger. Wenn Goethe sagt: «Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß' ich's Wahrheit. Und so kann jeder seine eigene Wahrheit haben und es ist doch immer dieselbige» («Sprüche in Prosa»; Natw. Schr., 4. Bd., 2. Abt., S. 349), so ist das nur mit Voraussetzung dessen, was wir hier entwickelt haben, zu verstehen.
2. Dogmatische und immanente Methode
[ 5 ] Ein wissenschaftliches Urteil kommt dadurch zustande, daß wir entweder zwei Begriffe oder eine Wahrnehmung und einen Begriff verbinden. Von der ersteren Art ist das Urteil: Keine Wirkung ohne Ursache; von der letzteren: Die Tulpe ist eine Pflanze. Das tägliche Leben erkennt dann auch noch Urteile, wo Wahrnehmung mit Wahrnehmung verbunden wird, z. B.: Die Rose ist rot. Wenn wir ein Urteil vollziehen, so geschieht dies aus diesem oder jenem Grunde. Nun kann es über diesen Grund zwei verschiedene Ansichten geben. Die eine nimmt an, daß die sachlichen (objektiven) Gründe, warum das Urteil, das wir vollziehen, wahr ist, jenseits dessen liegen, was uns in den in das Urteil eingehenden Begriffen oder Wahrnehmungen gegeben ist. Der Grund, warum ein Urteil wahr ist, fällt nach dieser Ansicht nicht zusammen mit den subjektiven Gründen, aus denen wir dieses Urteil fällen. Unsere logischen Gründe haben nach dieser Ansicht mit den objektiven nichts zu tun. Es kann sein, daß diese Ansicht irgendeinen Weg vorschlägt, um zu den objektiven Gründen unserer Einsicht zu kommen; die Mittel, die unser erkennendes Denken hat, reichen dazu nicht aus. Für das Erkennen liegt die meine Behauptungen bedingende objektive Wesenheit in einer mir unbekannten Welt; die Behauptung mit ihren formellen Gründen (Widerspruchslosigkeit, Stützung durch verschiedene Axiome usw.) allein in der meinigen. Eine Wissenschaft, die auf dieser Anschauung beruht, ist eine dogmatische. Eine solche dogmatische Wissenschaft ist sowohl die theologisierende Philosophie, die sich auf den Offenbarungsglauben stützt, als auch die moderne Erfahrungswissenschaft; denn es gibt nicht nur ein Dogma der Offenbarung, es gibt auch ein Dogma der Erfahrung. Das Dogma der Offenbarung überliefert dem Menschen Wahrheiten über Dinge, die seinem Gesichtskreise völlig entzogen sind. Er kennt die Welt nicht, über die ihm die fertigen Behauptungen zu glauben vorgeschrieben wird. Er kann an die Gründe der letzteren nicht herankommen. Er kann daher nie eine Einsicht gewinnen, warum sie wahr sind. Er kann kein Wissen, nur einen Glauben gewinnen. Dagegen sind aber auch die Behauptungen jener Erfahrungswissenschaft bloße Dogmen, die da glaubt, daß man bei der bloßen, reinen Erfahrung stehen bleiben soll und nur deren Veränderungen beobachten, beschreiben und systematisch zusammenstellen soll, ohne sich zu den in der bloßen unmittelbaren Erfahrung noch nicht gegebenen Bedingungen zu erheben. Wir gewinnen ja die Wahrheit auch in diesem Falle nicht durch die Einsicht in die Sache, sondern sie wird uns von außen aufgedrängt. Ich sehe, was vorgeht und da ist, und registriere es; warum das so ist, das liegt im Objekte. Ich sehe nur die Folge, nicht den Grund. Das Dogma der Offenbarung beherrschte ehedem die Wissenschaft, heute tut es das Dogma der Erfahrung. Ehedem galt es als Vermessenheit, über die Gründe der geoffenbarten Wahrheiten nachzudenken; heute gilt es als Unmöglichkeit, anderes zu wissen, als was die Tatsachen aussprechen. Das «Warum sie so und nicht anders sprechen» gilt als unerfahrbar und deshalb unerreichbar.
[ 6 ] Unsere Ausführungen haben gezeigt, daß die Annahme eines Grundes, warum ein Urteil wahr ist, neben dem, warum wir es als wahr anerkennen, ein Unding ist. Wenn wir bis zu dem Punkte vordringen, wo uns die Wesenheit einer Sache als Idee aufgeht, so erblicken wir in der letzteren etwas völlig in sich Abgeschlossenes, etwas sich selbst Stützendes und Tragendes, das gar keine Erklärung von außen mehr fordert, so daß wir dabei stehenbleiben können. Wir sehen an der Idee - wenn wir nur die Fähigkeit dazu haben -, daß sie alles, was sie konstituiert, in sich selber hat, daß wir mit ihr alles haben, wonach gefragt werden kann. Der gesamte Seinsgrund ist in der Idee aufgegangen, hat sich in sie ergossen, rückhaltlos, so daß wir ihn nirgends als in ihr zu suchen haben. In der Idee haben wir nicht ein Bild von dem, was wir zu den Dingen suchen; wir haben dieses Gesuchte selbst. Indem die Teile unserer Ideenwelt in den Urteilen zusammenfließen, ist es der eigene Inhalt derselben, der das bewirkt, nicht Gründe, die außerhalb liegen. In unserem Denken sind die sachlichen und nicht bloß die formellen Gründe für unsere Behauptungen unmittelbar gegenwärtig.
[ 7 ] Damit ist die Ansicht abgewiesen, welche eine außerideelle absolute Realität annimmt, von denen alle Dinge einschließlich des Denkens selbst, getragen werden. Für diese Weltansicht kann der Grund zu dem Bestehenden überhaupt nicht in dem uns Erreichbaren gefunden werden. Er ist der uns vorliegenden Welt nicht eingeboren, er ist außerhalb ihrer vorhanden; ein Wesen für sich, das neben ihr besteht. Diese Ansicht kann man Realismus nennen. Sie tritt in zwei Formen auf. Sie nimmt entweder eine Vielzahl von realen Wesen an, die der Welt zum Grunde liegen (Leibniz, Herbart), oder ein einheitliches Reales (Schopenhauer). Ein solches Seiendes kann nie als mit der Idee identisch erkannt werden; es ist schon als wesensverschieden von ihr vorausgesetzt. Wer sich des klaren Sinnes der Frage nach dem Wesen der Erscheinungen bewußt wird, kann ein Anhänger dieses Realismus nicht sein. Was hat es denn für einen Sinn, nach dem Wesen der Welt zu fragen? Es hat gar keinen andern Sinn, als daß, wenn ich einem Dinge gegenübertrete, sich in mir eine Stimme geltend macht, die mir sagt, daß das Ding letzten Endes noch etwas ganz anderes ist, als was ich sinnfällig wahrnehme. Das, was es noch ist, arbeitet schon in mir, drängt in mir zur Erscheinung, während ich das Ding außer mir erblicke. Nur weil die in mir arbeitende Ideenwelt mich drängt, die mich umgebende Welt aus ihr zu erklären, fordere ich eine solche Erklärung. Für ein Wesen, in dem sich keine Ideen emporarbeiten, ist der Drang, die Dinge noch weiter zu erklären, nicht da; sie sind an der sinnfälligen Erscheinung vollbefriedigt. Die Forderung nach Erklärung der Welt geht hervor aus dem Bedürfnisse des Denkens, den für letzteres erreichbaren Inhalt mit der erscheinenden Wirklichkeit in eins zu verschmelzen, alles begrifflich zu durchdringen; das was wir sehen, hören usw., zu einem solchen zu machen, das wir verstehen. Wer diese Sätze ihrer vollen Tragweite nach in Erwägung zieht, kann unmöglich ein Anhänger des oben charakterisierten Realismus sein. Die Welt durch ein Reales, das nicht Idee ist, erklären zu wollen, ist ein solcher Widerspruch, daß man gar nicht begreift, wie es überhaupt möglich ist, daß er Anhänger gewinnen konnte. Das uns wahrnehmbare Wirkliche durch irgend etwas zu erklären, was sich innerhalb des Denkens gar nicht geltend macht, ja was grundsätzlich verschieden von dem Gedanklichen sein soll, können wir weder das Bedürfnis haben, noch ist ein solches Beginnen möglich. Erstens: Woher sollen wir das Bedürfnis haben, die Welt durch etwas zu erklären, das sich uns nirgends aufdrängt, das sich uns verbirgt? Und nehmen wir an, es trete uns entgegen, dann entsteht wieder die Frage: in welcher Form und wo? Im Denken kann es doch nicht sein. Und selbst wieder in der äußeren oder inneren Wahrnehmung? Was soll es denn dann für einen Sinn haben, die Sinneswelt durch qualitativ Gleichstehendes zu erklären. Bliebe nur noch ein Drittes: die Annahme, wir hätten ein Vermögen, das außergedankliche und realste Wesen auf anderem Wege als durch Denken und Wahrnehmung zu erreichen. Wer diese Annahme macht, ist in den Mystizismus verfallen. Wir haben uns mit ihm nicht zu befassen; denn uns geht nur das Verhältnis von Denken und Sein, von Idee und Wirklichkeit an. Für den Mystizismus muß ein Mystiker eine Erkenntnistheorie schreiben. Der Standpunkt des späteren Schelling, wonach wir mit Hilfe unserer Vernunft nur das Was des Weltinhaltes entwickeln, nicht aber das Daß erreichen können, erscheint uns als das größte Unding. Denn für uns ist das Daß die Voraussetzung des Was, und wir wüßten nicht, wie wir zu dem Was eines Dinges kommen sollten, dessen Daß nicht vorher schon sichergestellt wäre. Das Daß wohnt doch dem Inhalt meiner Vernunft schon inne, indem ich sein Was ergreife. Diese Annahme Schellings, daß wir einen positiven Weltinhalt haben können, ohne die Überzeugung, daß er existiere, und daß wir dieses Daß erst durch höhere Erfahrung gewinnen müssen, erscheint uns vor einem sich selbst verstehenden Denken so unbegreiflich, daß wir annehmen müssen, Schelling habe in seiner späteren Zeit den Standpunkt seiner Jugend, der auf Goethe einen so mächtigen Eindruck machte, selbst nicht mehr verstanden.
[ 8 ] Es geht nicht an, höhere Daseinsformen anzunehmen als die, welche der Ideenwelt zukommen. Nur weil der Mensch oft nicht imstande ist, zu begreifen, daß das Sein der Idee ein weit höheres, volleres ist als das der wahrgenommenen Wirklichkeit, sucht er noch eine weitere Realität. Er hält das Ideen-Sein für ein Chimärenhaftes, der Durchtränkung mit dem Realen Entbehrendes und ist damit nicht zufrieden. Er kann eben die Idee in ihrer Positivität nicht erfassen, er hat sie nur als Abstraktes; er ahnt ihre Fülle, ihre innere Vollendetheit und Gediegenheit nicht. Wir müssen aber an die Bildung die Anforderung stellen, daß sie sich hinaufarbeite bis zu jenem höheren Standpunkt, wo auch ein Sein, das nicht mit Augen gesehen, nicht mit Händen gegriffen, sondern mit der Vernunft erfaßt werden muß, als Reales angesehen wird. Wir haben also eigentlich einen Idealismus begründet, der Realismus zugleich ist. Unser Gedankengang ist: das Denken drängt nach Erklärung der Wirklichkeit aus der Idee. Es verbirgt dieses Drängen in die Frage: Was ist das Wesen der Wirklichkeit? Nach dem Inhalt dieses Wesens selbst fragen wir erst am Ende der Wissenschaft, wir machen es nicht wie der Realismus, der ein Reales voraussetzt, um daraus dann die Wirklichkeit abzuleiten. Wir unterscheiden uns von dem Realismus durch das volle Bewußtsein davon, daß wir ein Mittel, die Welt zu erklären, nur in der Idee haben. Auch der Realismus hat nur dieses Mittel, aber er weiß es nicht. Er leitet die Welt aus Ideen ab, aber er glaubt, er leite sie aus einer anderen Realität her. Leibnizens Monadenwelt ist nichts als eine Ideenwelt; aber Leibniz glaubt in ihr eine höhere Realität als eine ideelle zu besitzen. Alle Realisten machen den gleichen Fehler: sie sinnen Wesen aus und werden nicht gewahr, daß sie aus der Idee nicht herauskommen. Wir haben diesen Realismus abgewiesen, weil er sich über die Ideenwesenheit seines Weltgrundes täuscht; wir haben aber auch jenen falschen Idealismus abzuweisen, der da glaubt, weil wir über die Idee nicht hinauskommen, kommen wir über unser Bewußtsein nicht hinaus, und es seien alle uns gegebenen Vorstellungen und alle Welt nur subjektiver Schein, nur ein Traum, den unser Bewußtsein träumt (Fichte). Diese Idealisten begreifen wieder nicht, daß, obzwar wir über die Idee nicht hinauskommen, wir doch in der Idee das Objektive haben, das in sich selbst und nicht im Subjekt Gegründete. Sie bedenken nicht, daß, wenn wir auch nicht aus der Einheitlichkeit des Denkens hinauskommen, wir mit dem vernünftigen Denken mitten in die volle Objektivität hineinkommen. Die Realisten begreifen nicht, daß das Objektive Idee ist, die Idealisten nicht, daß die Idee objektiv ist.
[ 9 ] Wir haben uns noch mit den Empiristen des Sinnenfälligen zu beschäftigen, die jedes Erklären des Wirklichen durch die Idee als eine unstatthafte philosophische Deduktion ansehen und das Stehenbleiben beim Sinnlich-Faßbaren fordern. Gegen diesen Standpunkt können wir einfach das sagen, daß seine Forderung doch nur eine methodische, nur eine formelle sein kann. Wir sollen beim Gegebenen stehen bleiben, heißt doch nur: wir sollen uns das aneignen, was uns gegenübertritt. Über das Was desselben kann dieser Standpunkt am allerwenigsten etwas ausmachen; denn dieses Was muß ihm eben von dem Gegebenen selbst kommen. Wie man mit der Forderung der reinen Erfahrung zugleich fordern kann, nicht über die Sinnenwelt hinauszugehen, da doch die Idee ebenso die Forderung des Gegebenseins erfüllen kann, ist uns völlig unbegreiflich. Das positivistische Erfahrungsprinzip muß die Frage ganz offen lassen, was gegeben ist, und vereinigt sich somit ganz gut mit einem idealistischen Forschungsresultat. Dann aber ist diese Forderung ebenfalls mit der unseren zusammenfallend. Und wir vereinigen in unserer Ansicht alle Standpunkte, insofern sie Berechtigung haben. Unser Standpunkt ist Idealismus, weil er in der Idee den Weltgrund sieht; er ist Realismus, weil er die Idee als das Reale anspricht; und er ist Positivismus oder Empirismus, weil er zu dem Inhalt der Idee nicht durch apriorische Konstruktion, sondern zu ihm als einem Gegebenen kommen will. Wir haben eine empirische Methode, die in das Reale dringt und sich im idealistischen Forschungsresultat zuletzt befriedigt. Ein Schließen von einem Gegebenen als einem Bekannten auf ein zugrunde liegendes Nicht-Gegebenes, Bedingendes kennen wir nicht. Einen Schluß, wo irgendein Glied des Schlusses nicht gegeben ist, weisen wir ab. Das Schließen ist nur ein Übergehen von gegebenen Elementen zu anderen ebenso gegebenen. Wir verbinden im Schlusse a mit b durch c; aber alles das muß gegeben sein. Wenn Volkelt sagt, unser Denken drängt uns dazu, zu dem Gegebenen eine Voraussetzung zu machen und es zu überschreiten, so sagen wir: in unserem Denken drängt uns schon das, was wir zu dem unmittelbar Gegebenen hinzufügen wollen. Wir müssen daher jede Metaphysik abweisen. Die Metaphysik will ja das Gegebene durch ein Nicht-Gegebenes, Erschlossenes erklären (Wolff, Herbart). Wir sehen in dem Schließen nur eine formelle Tätigkeit, die zu nichts Neuem führt, die nur Übergänge zwischen Positiv-Vorliegendem herbeiführt.*
3. System der Wissenschaft
[ 10 ] Welche Gestalt hat die fertige Wissenschaft im Lichte der Goetheschen Denkweise? Vor allem müssen wir festhalten, daß der gesamte Inhalt der Wissenschaft ein Gegebenes ist; teils gegeben als Sinnenwelt von außen, teils als Ideenwelt von innen. Alle unsere wissenschaftliche Tätigkeit wird also darinnen bestehen, die Form, in der uns dieser Gesamtinhalt des Gegebenen gegenübertritt, zu überwinden und zu einer uns befriedigenden zu machen. Dies ist notwendig, weil die innerliche Einheitlichkeit des Gegebenen in der ersten Form des Auftretens, wo uns nur die äußere Oberfläche erscheint, verborgen bleibt. Nun stellt sich diese methodische Tätigkeit, die einen solchen Zusammenhang herstellt, verschieden heraus, je nach den Erscheinungsgebieten, die wir bearbeiten. Der erste Fall ist folgender: Wir haben eine Mannigfaltigkeit von sinnenfällig gegebenen Elementen. Diese stehen miteinander in Wechselbeziehung. Diese Wechselbeziehung wird uns klar, wenn wir uns ideell in die Sache vertiefen. Dann erscheint uns irgendeines der Elemente durch die andern mehr oder weniger und in dieser oder jener Weise bestimmt. Die Daseinsverhältnisse des einen werden uns durch die des andern begreiflich. Wir leiten die eine Erscheinung aus der andern ab. Die Erscheinung des erwärmten Steines leiten wir als Wirkung von den erwärmenden Sonnenstrahlen, als der Ursache, ab. Was wir an dem einen Dinge wahrnehmen, haben wir da erklärt, wenn wir es aus einem andern wahrnehmbaren ableiten. Wir sehen, in welcher Weise auf diesem Gebiete das ideelle Gesetz auftritt. Es umspannt die Dinge der Sinnenwelt, steht über ihnen. Es bestimmt die gesetzmäßige Wirkungsweise des einen Dinges, indem sie sie durch ein anderes bedingt sein läßt. Wir haben hier die Aufgabe, die Reihe der Erscheinungen so zusammenzustellen, daß eine aus der andern mit Notwendigkeit hervorgeht, daß sie alle ein Ganzes, durch und durch Gesetzmäßiges ausmachen. Das Gebiet, das in dieser Weise zu erklären ist, ist die unorganische Natur. Nun treten uns in der Erfahrung die einzelnen Erscheinungen keineswegs so gegenüber, daß das Nächste im Raum und in der Zeit auch das Nächste dem innern Wesen nach ist. Wir müssen erst von dem räumlich und zeitlich Nächsten zu dem begrifflich Nächsten übergehen. Wir müssen zu einer Erscheinung die dem Wesen nach sich unmittelbar an sie anschließenden suchen. Wir müssen trachten, eine sich selbst ergänzende, sich tragende, sich gegenseitig stützende Reihe von Tatsachen zusammenzustellen. Daraus gewinnen wir eine Gruppe von aufeinander wirkenden sinnenfälligen Elementen der Wirklichkeit; und das Phänomen, das sich vor uns abwickelt, folgt unmittelbar aus den in Betracht kommenden Faktoren in durchsichtiger, klarer Weise. Ein solches Phänomen nennen wir mit Goethe Urphänomen oder Grundtatsache. Dieses Urphänomen ist identisch mit dem objektiven Naturgesetz. Die hier besprochene Zusammenstellung kann entweder bloß in Gedanken geschehen, wie wenn ich die drei bei einem waagrecht geworfenen Stein in Betracht kommenden bedingenden Faktoren denke: 1. die Stoßkraft, 2. die Anziehungskraft der Erde und 3. den Luftwiderstand, und dann die Bahn des fliegenden Steines aus diesen Faktoren ableite, oder aber: ich kann die einzelnen Faktoren wirklich zusammenbringen und dann das aus ihrer Wechselwirkung folgende Phänomen abwarten. Das ist beim Versuche der Fall. Während uns ein Phänomen der Außenwelt unklar ist, weil wir nur das Bedingte (die Erscheinung), nicht die Bedingung kennen, ist uns das Phänomen, das der Versuch liefert, klar, denn wir haben die bedingenden Faktoren selbst zusammengestellt. Das ist der Weg der Naturforschung, daß sie von der Erfahrung ausgehe, um zu sehen, was wirklich ist; zu der Beobachtung fortschreite, um zu sehen, warum dieses wirklich ist, und sich dann zum Versuche steigere, um zu sehen, was wirklich sein kann. -
[ 11 ] Leider scheint gerade jener Aufsatz Goethes verloren gegangen zu sein, der diesen Ansichten am besten zur Stütze dienen könnte. Er ist eine Fortsetzung des Aufsatzes: «Der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt» gewesen. Wir wollen, von dem letzteren ausgehend, den möglichen Inhalt des ersteren nach der einzigen uns zugänglichen Quelle, dem Briefwechsel Goethes und Schillers, zu rekonstruieren suchen. Der Aufsatz: «Der Versuch usw. . . .» ist hervorgegangen aus jenen Studien Goethes, die er anstellte, um seine optischen Arbeiten zu rechtfertigen. Er ist dann liegen geblieben, bis der Dichter im Jahre 1798 diese Studien mit frischer Kraft aufnahm und in Gemeinschaft mit Schiller die Grundprinzipien der naturwissenschaftlichen Methode einer gründlichen und von allem wissenschaftlichen Ernst getragenen Untersuchung unterzog. Am 10. Januar 1798 (siehe Goethes Briefwechsel mit Schiller) schickte er nun den oben erwähnten Aufsatz an Schiller zur Erwägung und am 13. Januar kündigt er dem Freunde an, daß er willens sei, die dort ausgesprochenen Ansichten in einem neuen Aufsatze weiter auszuarbeiten. Dieser Arbeit unterzog er sich auch und schon am 17. Januar ging ein kleiner Aufsatz an Schiller ab, der eine Charakteristik der Methoden der Naturwissenschaft enthalten hat. Dieser Aufsatz findet sich nun in den Werken nicht. Er wäre unstreitig derjenige, der für die Würdigung von Goethes Grundanschauungen über die naturwissenschaftliche Methode die besten Anhaltspunkte gewährte. Wir können aber die Gedanken, die in demselben niedergelegt sind, aus dem ausführlichen Briefe Schillers vom 19. Januar 1798 (Briefwechsel Goethes mit Schiller) erkennen, wobei in Betracht kommt, daß wir zu dem daselbst Angedeuteten vielfache Belege und Ergänzungen in Goethes «Sprüchen in Prosa» finden. 93Vgl. Natw. Schr., 4. Bd., 2. Abt., S. 593, Anm In meiner Einleitung S. XXXVIII zum 34. Bande dieser Goethe-Ausgabe sagte ich: Leider scheint der Aufsatz verlorengegangen zu sein, der den Ansichten Goethes über Erfahrung, Versuch und wissenschaftliches Erkennen zur besten Stütze dienen könnte. Er ist aber nicht verlorengegangen, sondern hat sich in der obigen Form im Goethe-Archiv gefunden. (Vgl. Weim. Goethe-Ausgabe II. Abt. Band 11, S. 38ff.) Er trägt das Datum 15. Januar 1798 und ist am 17. an Schiller gesandt worden. Er stellt sich als Fortsetzung des Aufsatzes: Der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt˃ dar. Ich habe den Gedankengang des Aufsatzes aus dem Goethe-Schillerschen Briefwechsel entnommen und in genannter Einleitung S. XXXIX f. genau in der Weise angegeben, die sich jetzt vorgefunden hat. Inhaltlich wird durch den Aufsatz zu meinen Ausführungen nichts hinzugefügt; wohl aber wird meine aus Goethes übrigen Arbeiten gewonnene Ansicht über seine Methode und Erkenntnisweise in allen Punkten bestätigt.»
[ 12 ] Goethe unterscheidet drei Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung. Dieselben beruhen auf drei verschiedenen Auffassungen der Phänomene. Die erste Methode ist der gemeine Empirismus, der nicht über das empirische Phänomen, über den unmittelbaren Tatbestand hinausgeht. Er bleibt bei einzelnen Erscheinungen stehen. Will der gemeine Empirismus konsequent sein, so muß er seine ganze Tätigkeit darauf beschränken, jedes ihm aufstoßende Phänomen genau nach allen Einzelheiten zu beschreiben, d. i. den empirischen Tatbestand aufzunehmen. Wissenschaft wäre ihm nur die Summe aller dieser Einzelbeschreibungen aufgenommener Tatbestände. Gegenüber dem gemeinen Empirismus bildet nun der Rationalismus die nächst höhere Stufe. Dieser geht auf das wissenschaftliche Phänomen. Diese Anschauung beschränkt sich nicht mehr auf die bloße Beschreibung der Phänomene, sondern sie sucht dieselben durch Aufdeckung der Ursachen, durch Aufstellung von Hypothesen usw. zu erklären. Es ist die Stufe, wo der Verstand aus den Erscheinungen auf deren Ursachen und Zusammenhänge schließt. Sowohl die erstere wie die letzte Methode erklärt Goethe für Einseitigkeiten. Der gemeine Empirismus ist die rohe Unwissenschaft, weil er nie aus der bloßen Auffassung der Zufälligkeiten herauskommt; der Rationalismus dagegen interpretiert in die Erscheinungswelt Ursachen und Zusammenhänge hinein, die nicht in derselben sind. Jener kann sich aus der Fülle der Erscheinungen nicht zum freien Denken erheben, dieser verliert dieselbe als den sicheren Boden unter seinen Füßen und verfällt der Willkür der Einbildungskraft und des subjektiven Einfalles. Goethe rügt die Sucht, mit Erscheinungen sogleich durch subjektive Wirkungen Folgerungen zu verbinden, mit den schärfsten Worten, so «Sprüche in Prosa»; Natw. Schr., 4. Bd., 2. Abt., S. 375: «Es ist eine schlimme Sache, die doch manchem Beobachter begegnet, mit einer Anschauung sogleich eine Folgerung zu verknüpfen und beide für gleichgeltend zu achten», und: «Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt. Man ahnet, man sieht wohl auch, daß es nur ein Behelf ist; liebt nicht aber Leidenschaft und Parteigeist jederzeit Behelfe? Und mit Recht, da sie ihrer so sehr bedürfen.» (Ebenda S. 376) Besonders tadelt Goethe den Mißbrauch, den die Kausalbestimmung veranlaßt. Der Rationalismus in seiner ungezügelten Phantastik sucht dort Kausalität, wo sie, durch die Fakten zu suchen, nicht geboten ist. In «Sprüche in Prosa» (ebenda S. 371) heißt es: «Der eingeborenste Begriff, der notwendigste, von Ursache und Wirkung, wird in der Anwendung die Veranlassung zu unzähligen sich immer wiederholenden Irrtümern.» Namentlich führt ihn seine Sucht nach einfachen Verbindungen dahin, die Phänomene wie die Glieder einer Kette nach Ursache und Wirkung rein der Länge nach aneinandergereiht zu denken; während die Wahrheit doch ist, daß irgendeine Erscheinung, die durch eine der Zeit nach frühere kausal bedingt ist, zugleich auch noch von vielen andern Einwirkungen abhängt. Es wird in diesem Falle bloß die Länge und nicht die Breite der Natur in Anschlag gebracht. Beide Wege, der gemeine Empirismus und der Rationalismus, sind nun für Goethe wohl Durchgangspunkte für die höchste wissenschaftliche Methode, aber eben nur Durchgangspunkte, die überwunden werden müssen. Und dies geschieht mit dem rationellen Empirismus, der sich mit dem reinen Phänomen, das identisch mit dem objektiven Naturgesetz ist, beschäftigt. Die gemeine Empirie, die unmittelbare Erfahrung bietet uns nur Einzelnes, Unzusammenhängendes, ein Aggregat von Erscheinungen. Das heißt, sie bietet uns das nicht als letzten Abschluß der wissenschaftlichen Betrachtung, wohl aber als erste Erfahrung. Unser wissenschaftliches Bedürfnis sucht aber nur Zusammenhängendes, begreift das Einzelne nur als Glied einer Verbindung. So gehen das Bedürfnis des Begreifens und die Tatsachen der Natur scheinbar auseinander. Im Geiste ist nur Zusammenhang, in der Natur nur Sonderung, der Geist erstrebt die Gattung, die Natur schafft nur Individuen. Die Lösung dieses Widerspruchs ergibt sich aus der Erwägung, daß einerseits die verbindende Kraft des Geistes inhaltslos ist, somit allein, durch sich selbst, nichts Positives erkennen kann, daß andererseits die Sonderung der Naturobjekte nicht in deren Wesen selbst begründet ist, sondern in deren räumlicher Erscheinung, daß vielmehr bei Durchdringung des Wesens des Individuellen, des Besonderen, dieses selbst uns auf die Gattung hinweist. Weil die Objekte der Natur in der Erscheinung gesondert sind, bedarf es der zusammenfassenden Kraft des Geistes, ihre innere Einheit zu zeigen. Weil die Einheit des Verstandes für sich leer ist, muß er sie mit den Objekten der Natur erfüllen. So kommen auf dieser dritten Stufe Phänomen und Geistesvermögen einander entgegen und gehen in eins auf und der Geist kann jetzt erst vollbefriedigt sein. -
[ 13 ] Ein weiteres Gebiet der Forschung ist jenes, wo uns das Einzelne in seiner Daseinsweise nicht als die Folge eines andern, neben ihm Bestehenden erscheint, wo wir es daher auch nicht dadurch begreifen, daß wir ein anderes, Gleichartiges zu Hilfe rufen. Hier erscheint uns eine Reihe von sinnenfälligen Erscheinungselementen als unmittelbare Ausgestaltung eines einheitlichen Prinzipes, und wir müssen zu diesem Prinzipe vordringen, wenn wir die Einzelerscheinung begreifen wollen. Wir können auf diesem Gebiete das Phänomen nicht aus äußerer Einwirkung erklären, wir müssen es von innen heraus ableiten. Was früher bestimmend war, ist jetzt bloß veranlassend. Während ich beim früheren Gebiet alles begriffen habe, wenn es mir gelungen ist, es als Folge eines andern anzusehen, es von einer äußeren Bedingung abzuleiten, werde ich hier zu einer andern Fragestellung gezwungen. Wenn ich den äußeren Einfluß kenne, so habe ich noch keinen Aufschluß darüber erlangt, daß das Phänomen gerade in dieser und keiner anderen Weise abläuft. Ich muß es von dem zentralen Prinzip jenes Dinges ableiten, auf das der äußere Einfluß stattgefunden hat. Ich kann nicht sagen: dieser äußere Einfluß hat diese Wirkung; sondern nur: auf diesen bestimmten äußeren Einfluß antwortet das innere Wirkungsprinzip in dieser bestimmten Weise. Was geschieht, ist Folge einer inneren Gesetzlichkeit. Ich muß also diese innere Gesetzlichkeit kennen. Ich muß erforschen, was sich von innen heraus gestaltet. Dieses sich gestaltende Prinzip, das auf diesem Gebiete jedem Phänomen zugrunde liegt, das ich in allem zu suchen habe, ist der Typus. Wir sind im Gebiete der organischen Natur. Was in der unorganischen Natur Urphänomen, das ist in der Organik Typus. Der Typus ist ein allgemeines Bild des Organismus: die Idee desselben; die Tierheit im Tiere. Wir mußten hier die Hauptpunkte des schon in einem früheren Abschnitte über den «Typus» Ausgeführten wegen des Zusammenhangs noch einmal anführen. In den ethischen und historischen Wissenschaften haben wir es dann mit der Idee im engeren Sinne zu tun. Die Ethik und die Geschichte sind Idealwissenschaften. Ihre Wirklichkeit sind Ideen. - Der Einzelwissenschaft obliegt es, das Gegebene so weit zu bearbeiten, daß sie es bis zu Urphänomen, Typus und den leitenden Ideen in der Geschichte bringt. «Kann... der Physiker zur Erkenntnis desjenigen gelangen, was wir ein Urphänomen genannt haben, so ist er geborgen und der Philosoph mit ihm; er, denn er überzeugt sich, daß er an die Grenze seiner Wissenschaft gelangt sei, daß er sich auf der empirischen Höhe befinde, wo er rückwärts die Erfahrung in allen ihren Stufen überschauen und vorwärts in das Reich der Theorie, wo nicht eintreten, doch einblicken könne. Der Philosoph ist geborgen, denn er nimmt aus des Physikers Hand ein Letztes, das bei ihm nun ein Erstes wird» («Entwurf einer Farbenlehre» 720 [Natw. Schr., 3. Bd., S. 275 f.]) - Hier tritt nämlich der Philosoph mit seiner Arbeit auf. Er ergreift die Urphänomene und bringt sie in den befriedigenden ideellen Zusammenhang. Wir sehen, durch was im Sinne der Goetheschen Weltanschauung die Metaphysik zu ersetzen ist: durch eine ideengemäße Betrachtung, Zusammenstellung und Ableitung der Urphänomene. In diesem Sinne spricht sich Goethe wiederholt über das Verhältnis von empirischer Wissenschaft und Philosophie aus; besonders deutlich in seinen Briefen an Hegel. Goethe spricht in den Annalen wiederholt von einem Schema der Naturwissenschaft. Wenn sich dasselbe vorfände, würden wir daraus ersehen, wie er sich selbst das Verhältnis der einzelnen Urphänomene untereinander dachte; wie er sie in eine notwendige Kette zusammenstellte. Eine Vorstellung davon gewinnen wir auch, wenn wir die Tabelle berücksichtigen, die er im 1. Bd. 4. H. «Zur Naturwissenschaft» von allen möglichen Wirkungsarten gibt:
Zufällig
Mechanisch
Physisch
Chemisch
Organisch
Psychisch
Ethisch
Religiös
Genial
[ 14 ] Nach dieser aufsteigenden Reihe hätte man sich bei Anordnung der Urphänomene zu richten.*
4. Über Erkenntnisgrenzen und Hypothesenbildung
[ 15 ] Man spricht heute viel von Grenzen unseres Erkennens. Unsere Fähigkeit, das Bestehende zu erklären, soll nur bis zu einem gewissen Punkte reichen, bei dem sollen wir haltmachen. Wir glauben in bezug auf diese Frage das Richtige zu treffen, wenn wir sie richtig stellen. Denn es kommt ja so vielfach nur auf eine richtige Fragestellung an. Durch eine solche wird ein ganzes Heer von Irrtümern zerstreut. Wenn wir bedenken, daß der Gegenstand, in bezug auf welchen sich in uns ein Erklärungsbedürfnis geltend macht, gegeben sein muß, so ist es klar, daß das Gegebene selbst uns eine Grenze nicht setzen kann. Denn um überhaupt den Anspruch zu erheben, erklärt, begriffen zu werden, muß es uns innerhalb der gegebenen Wirklichkeit gegenübertreten. Was nicht in den Horizont des Gegebenen eintritt, braucht nicht erklärt zu werden. Die Grenze könnte also nur darinnen liegen, daß uns einem gegebenen Wirklichen gegenüber die Mittel fehlen, es zu erklären. Nun kommt unser Erklärungsbedürfnis aber gerade daher, daß das, als was wir ein Gegebenes ansehen wollen, durch was wir es erklären wollen, sich in den Horizont des uns gedanklich Gegebenen eindrängt. Weit entfernt, daß das erklärende Wesen eines Dinges uns unbekannt wäre, ist es vielmehr selbst das, was durch sein Auftreten im Geiste die Erklärung notwendig macht. Was erklärt werden soll und durch was dieses erklärt werden soll, liegen vor. Es handelt sich nur um die Verbindung beider. Das Erklären ist kein Suchen eines Unbekannten, nur eine Auseinandersetzung über den gegenseitigen Bezug zweier Bekannter. Durch irgend etwas ein Gegebenes zu erklären, von dem wir kein Wissen haben, sollte uns nie der Einfall kommen. Es kann also von prinzipiellen Grenzen des Erklärens gar nicht die Rede sein. Nun kommt da freilich etwas in Betracht, was der Theorie einer Erkenntnisgrenze einen Schein von Recht gibt. Es kann sein, daß wir von einem Wirklichen zwar ahnen, daß es da ist, daß es aber doch unserer Wahrnehmung entrückt ist. Wir können irgendwelche Spuren, Wirkungen eines Dinges wahrnehmen und dann die Annahme machen, daß dies Ding vorhanden ist. Und hier kann etwa von einer Grenze des Wissens gesprochen werden. Das, was wir als nicht erreichbar voraussetzen, ist hier aber kein solches, aus dem irgend etwas prinzipiell zu erklären wäre; es ist ein Wahrzunehmendes, wenn auch kein Wahrgenommenes. Die Hindernisse, warum ich es nicht wahrnehme, sind keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen, sondern rein zufällige, äußere. Ja sie können wohl gar überwunden werden. Was ich heute bloß ahne, kann ich morgen erfahren. Das ist aber mit einem Prinzip nicht so; da gibt es keine äußeren Hindernisse, die ja zumeist nur in Ort und Zeit liegen; das Prinzip ist mir innerlich gegeben. Ich ahne es nicht aus einem andern, wenn ich es nicht selbst erschaue.
[ 16 ] Damit hängt nun die Theorie der Hypothese zusammen. Eine Hypothese ist eine Annahme, die wir machen und von deren Wahrheit wir uns nicht direkt, sondern nur durch ihre Wirkungen überzeugen können. Wir sehen eine Erscheinungsreihe. Sie ist uns nur erklärlich, wenn wir etwas zugrunde legen, das wir nicht unmittelbar wahrnehmen. Darf eine solche Annahme sich auf ein Prinzip erstrecken? Offenbar nicht. Denn ein Inneres, das ich voraussetze, ohne es gewahr zu werden, ist ein vollkommener Widerspruch. Die Hypothese kann nur solches annehmen, das ich zwar nicht wahrnehme, aber sofort wahrnehmen würde, wenn ich die äußeren Hindernisse wegräumte. Die Hypothese kann zwar nicht Wahrgenommenes, sie muß aber Wahrnehmbares voraussetzen. So ist jede Hypothese in dem Fall, daß ihr Inhalt durch eine künftige Erfahrung direkt bestätigt werden kann. Nur Hypothesen, die aufhören können es zu sein, haben eine Berechtigung. Hypothesen über zentrale Wissenschaftsprinzipien haben keinen Wert. Was nicht durch ein positiv gegebenes Prinzip, das uns bekannt ist, erklärt wird, das ist überhaupt einer Erklärung nicht fähig und auch nicht bedürftig.
5. Ethische und historische Wissenschaften
[ 17 ] Die Beantwortung der Frage: «Was ist Erkennen?» hat uns über die Stellung des Menschen im Weltall aufgeklärt. Es kann nun nicht fehlen, daß die Ansicht, die wir für diese Frage entwickelt haben, auch über Wert und Bedeutung des menschlichen Handelns Licht verbreitet. Was wir in der Welt vollbringen, dem müssen wir ja eine größere oder geringere Bedeutung beilegen, je nachdem wir unsere Bestimmung höher oder minder bedeutend auffassen.
[ 18 ] Die erste Aufgabe, der wir uns nun zu unterziehen haben, wird die Untersuchung des Charakters der menschlichen Tätigkeit sein. Wie stellt sich das, was wir als Wirkung menschlichen Tuns auffassen müssen, zu anderen Wirksamkeiten innerhalb des Weltprozesses? Betrachten wir zwei Dinge: ein Naturprodukt und ein Geschöpf menschlicher Tätigkeit, die Kristallgestalt und etwa ein Wagenrad. In beiden Fällen erscheint uns das vorliegende Objekt als Ergebnis von in Begriffen ausdrückbaren Gesetzen. Der Unterschied liegt nur darinnen, daß wir den Kristall als das unmittelbare Produkt der ihn bestimmenden Naturgesetzlichkeiten ansehen müssen, während beim Wagenrad der Mensch in die Mitte zwischen Begriff und Gegenstand tritt. Was wir im Naturprodukt als dem Wirklichen zugrunde liegend denken, das führen wir in unserem Handeln in die Wirklichkeit ein. Im Erkennen erfahren wir, welches die ideellen Bedingungen der Sinneserfahrung sind; wir bringen die Ideenwelt, die in der Wirklichkeit schon liegt, zum Vorschein; wir schließen also den Weltprozess in der Hinsicht ab, daß wir den Produzenten, der ewig die Produkte hervorgehen läßt, aber ohne unser Denken ewig in ihnen verborgen bliebe, zur Erscheinung rufen. Im Handeln aber ergänzen wir diesen Prozess dadurch, daß wir die Ideenwelt, insofern sie noch nicht Wirklichkeit ist, in solche umsetzen. Nun haben wir die Idee als das erkannt, was allem Wirklichen zugrunde liegt, als das Bedingende, die Intention der Natur. Unser Erkennen führt uns dahin, die Tendenz des Weltprozesses, die Intention der Schöpfung aus den in der uns umgebenden Natur enthaltenen Andeutungen zu finden. Haben wir das erreicht, dann ist unserem Handeln die Aufgabe zuerteilt, selbständig an der Verwirklichung jener Intention mitzuarbeiten. Und so erscheint uns unser Handeln direkt als eine Fortsetzung jener Art von Wirksamkeit, die auch die Natur erfüllt. Es erscheint uns als unmittelbarer Ausfluß des Weltgrundes. Aber doch welch ein Unterschied ist da gegenüber der anderen (Natur-)Tätigkeit! Das Naturprodukt hat keineswegs in sich selbst die ideelle Gesetzmäßigkeit, von der es beherrscht erscheint. Es bedarf bei ihm des Gegenübertretens eines höheren, des menschlichen Denkens; dann erscheint diesem das, wovon jenes beherrscht wird. Beim menschlichen Tun ist das anders. Da wohnt dem tätigen Objekte unmittelbar die Idee inne; und träte ihm ein höheres Wesen gegenüber, so könnte es in seiner Tätigkeit nichts anderes finden, als was dieses selbst in sein Tun gelegt hat. Denn ein vollkommenes menschliches Handeln ist das Ergebnis unserer Absichten und nur dieses. Blicken wir ein Naturprodukt an, das auf ein anderes wirkt, so stellt sich die Sache so: Wir sehen eine Wirkung; diese Wirkung ist bedingt durch in Begriffe zu fassende Gesetze. Wollen wir aber die Wirkung begreifen, da genügt es nicht, daß wir sie mit irgendwelchen Gesetzen zusammenhalten, wir müssen ein zweites wahrzunehmendes - allerdings wieder ganz in Begriffe aufzulösendes - Ding haben. Wenn wir einen Eindruck in dem Boden sehen, so suchen wir nach dem Gegenstande, der ihn gemacht hat. Das führt zu dem Begriffe einer solchen Wirkung, wo die Ursache einer Erscheinung wieder in Form einer äußeren Wahrnehmung erscheint, d. i. aber um Begriffe der Kraft. Die Kraft kann uns nur da entgegentreten, wo die Idee zuerst an einem Wahrnehmungsobjekte erscheint und erst unter dieser Form auf ein anderes Objekt wirkt. Der Gegensatz hierzu ist, wenn diese Vermittlung wegfällt, wenn die Idee unmittelbar an die Sinnenwelt herantritt. Da erscheint die Idee selbst verursachend. Und hier ist es, wo wir vom Willen sprechen. Wille ist also die Idee selbst als Kraft aufgefaßt. Von einem selbständigen Willen zu sprechen ist völlig unstatthaft. Wenn der Mensch irgend etwas vollbringt, so kann man nicht sagen, es komme zu der Vorstellung noch der Wille hinzu. Spricht man so, so hat man die Begriffe nicht klar erfaßt, denn, was ist die menschliche Persönlichkeit, wenn man von der sie erfüllenden Ideenwelt absieht? Doch ein tätiges Dasein. Wer sie anders faßte: als totes, untätiges Naturprodukt, setzte sie ja dem Steine auf der Straße gleich. Dieses tätige Dasein ist aber ein Abstraktum, es ist nichts Wirkliches. Man kann es nicht fassen, es ist ohne Inhalt. Will man es fassen, will man einen Inhalt, dann erhält man eben die im Tun begriffene Ideenwelt. E. v. Hartmann macht dieses Abstraktum zu einem zweiten weltkonstituierenden Prinzip neben der Idee. Es ist aber nichts anderes als die Idee selbst, nur in einer Form des Auftretens. Wille ohne Idee wäre nichts. Das gleiche kann man nicht von der Idee sagen, denn die Tätigkeit ist ein Element von ihr, während sie die sich selbst tragende Wesenheit ist.*
[ 19 ] Dies zur Charakteristik des menschlichen Tuns. Wir schreiten zu einem weiteren wesentlichen Kennzeichen desselben, das aus dem bisher Gesagten sich mit Notwendigkeit ergibt. Das Erklären eines Vorganges in der Natur ist ein Zurückgehen auf die Bedingungen desselben: ein Aufsuchen des Produzenten zu dem gegebenen Produkte. Wenn ich eine Wirkung wahrnehme und dazu die Ursache suche, so genügen diese zwei Wahrnehmungen keineswegs meinem Erklärungsbedürfnisse. Ich muß zu den Gesetzen zurückgehen, nach denen diese Ursache diese Wirkung hervorbringt. Beim menschlichen Handeln ist das anders. Da tritt die eine Erscheinung bedingende Gesetzlichkeit selbst in Aktion; was ein Produkt konstituiert, tritt selbst auf den Schauplatz des Wirkens. Wir haben es mit einem erscheinenden Dasein zu tun, bei dem wir stehenbleiben können, bei dem wir nicht nach den tiefer liegenden Bedingungen zu fragen brauchen. Ein Kunstwerk haben wir begriffen, wenn wir die Idee kennen, die in demselben verkörpert ist; wir brauchen nach keinem weiteren gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Idee (Ursache) und Werk (Wirkung) zu fragen. Das Handeln eines Staatsmannes begreifen wir, wenn wir seine Intentionen (Ideen) kennen; wir brauchen nicht weiter über das, was in die Erscheinung tritt, hinauszugehen. Dadurch also unterscheiden sich Prozesse der Natur von Handlungen des Menschen, daß bei jenen das Gesetz als der bedingende Hintergrund des erscheinenden Daseins zu betrachten ist, während bei diesen das Dasein selbst Gesetz ist und von nichts als von sich selbst bedingt erscheint. Dadurch legt sich jeder Naturprozeß in ein Bedingendes und ein Bedingtes auseinander, und das letztere folgt mit Notwendigkeit aus dem ersten, während das menschliche Handeln nur sich selbst bedingt Das aber ist das Wirken mit Freiheit. Indem die Intentionen der Natur, die hinter den Erscheinungen stehen und sie bedingen, in den Menschen einziehen, werden sie selbst zur Erscheinung; aber sie sind jetzt gleichsam rückenfrei. Wenn alle Naturprozesse nur Manifestationen der Idee sind, so ist das menschliche Tun die agierende Idee selbst.
[ 20 ] Indem unsere Erkenntnistheorie zu dem Schlusse gekommen ist, daß der Inhalt unseres Bewußtseins nicht bloß ein Mittel sei, sich von dem Weltengrunde ein Abbild zu machen, sondern daß dieser Weltengrund selbst in seiner ureigensten Gestalt in unserem Denken zutage tritt, so können wir nicht anders, als im menschlichen Handeln auch unmittelbar das unbedingte Handeln jenes Urgrundes selbst erkennen. Einen Weltlenker, der außerhalb unserer selbst unseren Handlungen Ziel und Richtung setzte, kennen wir nicht. Der Weltlenker hat sich seiner Macht begeben, hat alles an den Menschen abgegeben, mit Vernichtung seines Sonderdaseins, und dem Menschen die Aufgabe zuerteilt: wirke weiter. Der Mensch findet sich in der Welt, erblickt die Natur, in derselben die Andeutung eines Tieferen, Bedingenden, einer Intention. Sein Denken befähigt ihn, diese Intention zu erkennen. Sie wird sein geistiger Besitz. Er hat die Welt durchdrungen; er tritt handelnd auf, jene Intentionen fortzusetzen. Damit ist die hier vorgetragene Philosophie die wahre Freiheitsphilosophie. Sie läßt für die menschlichen Handlungen weder die Naturnotwendigkeit gelten, noch den Einfluß eines außerweltlichen Schöpfers oder Weltlenkers. Der Mensch wäre in dem einen wie in dem andern Fall unfrei. Wirkte in ihm die Naturnotwendigkeit wie in den anderen Wesen, dann vollführte er seine Taten aus Zwang, dann wäre auch bei ihm ein Zurückgehen auf Bedingungen notwendig, die dem erscheinenden Dasein zugrunde liegen und von Freiheit keine Rede. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß es unzählige menschliche Verrichtungen gibt, die nur unter diesen Gesichtspunkt fallen; allein diese kommen hier nicht in Betracht. Der Mensch, insofern er ein Naturwesen ist, ist auch nach den für das Naturwirken geltenden Gesetzen zu begreifen. Allein weder als erkennendes noch als wahrhaft ethisches Wesen ist sein Auftreten aus bloßen Naturgesetzen einzusehen. Da tritt er eben aus der Sphäre der Naturwirklichkeiten heraus. Und für diese höchste Potenz seines Daseins, die mehr Ideal als Wirklichkeit ist, gilt das hier Festgestellte. Des Menschen Lebensweg besteht darinnen, daß er sich vom Naturwesen zu einem solchen entwickelt, wie wir es hier kennengelernt haben; er soll sich frei machen von allen Naturgesetzen und sein eigener Gesetzgeber werden.
[ 21 ] Aber auch den Einfluß eines außerweltlichen Lenkers der Menschengeschicke müssen wir ablehnen. Auch da, wo ein solcher angenommen wird, kann von wahrer Freiheit nicht die Rede sein. Da bestimmt er die Richtung des menschlichen Handelns und der Mensch hat auszuführen, was ihm jener zu tun vorgesetzt. Er empfindet den Antrieb zu seinen Handlungen nicht als Ideal, das er sich selbst vorsetzt, sondern als Gebot jenes Lenkers; wieder ist sein Handeln nicht unbedingt, sondern bedingt. Der Mensch fühlte sich dann eben nicht rückenfrei, sondern abhängig, nur Mittel für die Intentionen einer höheren Macht.
[ 22 ] Wir haben gesehen, daß der Dogmatismus darinnen besteht, daß der Grund, warum irgend etwas wahr ist, in einem unserem Bewußtsein Jenseitigen, Unzugänglichen (Transsubjektiven) gesucht wird, im Gegensatz zu unserer Ansicht, die ein Urteil nur deshalb wahr sein läßt, weil der Grund dazu in den im Bewußtsein liegenden, in das Urteil einfließenden Begriffen liegt. Wer sich einen Weltengrund außer unserer Ideenwelt denkt, der denkt sich, daß der ideale Grund, warum von uns etwas als wahr erkannt wird, ein anderer ist, als warum es objektiv wahr ist. So ist die Wahrheit als Dogma aufgefaßt. Und auf dem Gebiete der Ethik ist das Gebot das, was in der Wissenschaft das Dogma ist. Der Mensch handelt, wenn er die Antriebe zu seinem Handeln in Geboten sucht, nach Gesetzen, deren Begründung nicht von ihm abhängt; er denkt sich eine Norm, die von außen seinem Handeln vorgeschrieben ist. Er handelt aus Pflicht. Von Pflicht zu reden, hat nur bei dieser Auffassung Sinn. Wir müssen den Antrieb von außen empfinden und die Notwendigkeit anerkennen, ihm zu folgen, dann handeln wir aus Pflicht. Unsere Erkenntnistheorie kann ein solches Handeln, da wo der Mensch in seiner sittlichen Vollendung auftritt, nicht gelten lassen. Wir wissen daß die Ideenwelt die unendliche Vollkommenheit selbst ist; wir wissen, daß mit ihr die Antriebe unseres Handelns in uns liegen; und wir müssen demzufolge nur ein solches Handeln als ethisch gelten lassen, bei dem die Tat nur aus der in uns liegenden Idee derselben fließt. Der Mensch vollbringt von diesem Gesichtspunkte aus nur deshalb eine Handlung, weil deren Wirklichkeit für ihn Bedürfnis ist. Er handelt, weil ein innerer (eigener) Drang, nicht eine äußere Macht, ihn treibt. Das Objekt seines Handelns, sobald er sich einen Begriff davon macht, erfüllt ihn so, daß er es zu verwirklichen strebt. In dem Bedürfnis nach Verwirklichung einer Idee, in dem Drange nach der Ausgestaltung einer Absicht soll auch der einzige Antrieb unseres Handelns sein. In der Idee soll sich alles ausleben, was uns zum Tun drängt. Wir handeln dann nicht aus Pflicht, wir handeln nicht einem Triebe folgend, wir handeln aus Liebe zu dem Objekt, auf das unsere Handlung sich erstrecken soll. Das Objekt, indem wir es vorstellen, ruft in uns den Drang nach einer ihm angemessenen Handlung hervor. Ein solches Handeln ist allein ein freies. Denn müßte zu dem Interesse, das wir an dem Objekt nehmen, noch ein zweiter anderweitiger Anlaß kommen, dann wollten wir nicht dieses Objekt um seiner selbst willen, wir wollten ein anderes und vollbrächten dieses, was wir nicht wollen; wir vollführten eine Handlung gegen unseren Willen. Das wäre etwa beim Handeln aus Egoismus der Fall. Da nehmen wir an der Handlung selbst kein Interesse; sie ist uns nicht Bedürfnis, wohl aber der Nutzen, den sie uns bringt. Dann aber empfinden wir es auch zugleich als Zwang, daß wir jene Handlung, nur dieses Zweckes willen, vollbringen müssen. Sie selbst ist uns nicht Bedürfnis; denn wir unterließen sie, wenn sie den Nutzen nicht im Gefolge hätte. Eine Handlung aber, die wir nicht um ihrer selbst willen vollbringen, ist eine unfreie. Der Egoismus handelt unfrei. Unfrei handelt überhaupt jeder Mensch, der eine Handlung aus einem Anlaß vollbringt, der nicht aus dem objektiven Inhalt der Handlung selbst folgt. Eine Handlung um ihrer selbst willen ausführen, heißt aus Liebe handeln. Nur derjenige, den die Liebe zum Tun, die Hingabe an die Objektivität leitet, handelt wahrhaft frei. Wer dieser selbstlosen Hingabe nicht fähig ist, wird seine Tätigkeit nie als eine freie ansehen können.
[ 23 ] Soll das Handeln des Menschen nichts anderes sein als die Verwirklichung seines eigenen Ideengehaltes, dann ist es natürlich, daß solcher Gehalt in ihm liegen muß. Sein Geist muß produktiv wirken. Denn was sollte ihn mit dem Drange erfüllen, etwas zu vollbringen, wenn nicht eine sich in seinem Geiste heraufarbeitende Idee? Diese Idee wird sich um so fruchtbarer erweisen, in je bestimmteren Umrissen, mit je deutlicherem Inhalte sie im Geiste auftritt. Denn nur das kann uns ja mit aller Gewalt zur Verwirklichung drängen, das seinem ganzen «Was» nach vollbestimmt ist. Das nur dunkel vorgestellte, das unbestimmt gelassene Ideal ist als Antrieb des Handelns ungeeignet. Was soll uns an ihm eineifern, da sein Inhalt nicht offen und klar am Tage liegt. Die Antriebe für unser Handeln müssen daher immer in Form individueller Intentionen auftreten. Alles, was der Mensch Fruchtbringendes vollführt, verdankt solchen individuellen Impulsen seine Entstehung. Völlig wertlos erweisen sich allgemeine Sittengesetze, ethische Normen usw., die für alle Menschen Gültigkeit haben sollen. Wenn Kant nur dasjenige als sittlich gelten läßt, was sich für alle Menschen als Gesetz eignet, so ist demgegenüber zu sagen, daß alles positive Handeln aufhören müßte, alles Große aus der Welt verschwinden müßte, wenn jeder nur das tun sollte, was sich für alle eignet. Nein, nicht solche vage, allgemeine ethische Normen, sondern die individuellsten Ideale sollen unser Handeln leiten. Nicht alles ist für alle gleich würdig zu vollbringen, sondern dies für den, für jenen das, je nachdem einer den Beruf zu einer Sache fühlt. J. Kreyenbühl hat hierüber treffliche Worte in seinem Aufsatze «Die ethische Freiheit bei Kant» (Philosophische Monatshefte, Bd. XVIII, 3. H. [Berlin etc. 1882, S. 129ff.]) gesagt: «Soll ja die Freiheit meine Freiheit, die sittliche Tat meine Tat, soll das Gute und Rechte durch mich, durch die Handlung dieser besonderen individuellen Persönlichkeit verwirklicht werden, so kann mir unmöglich ein allgemeines Gesetz genügen, das von aller Individualität und Besonderheit der beim Handeln konkurrierenden Umstände absieht und mir befiehlt vor jeder Handlung zu prüfen, ob das ihr zugrunde liegende Motiv der abstrakten Norm der allgemeinen Menschennatur entspreche, ob es so, wie es in mir lebt und wirkt, allgemein gültige Maxime werden könne.» ... «Eine derartige Anpassung an das allgemein Übliche und Gebräuchliche würde jede individuelle Freiheit, jeden Fortschritt über das Ordinäre und Hausbackene, jede bedeutende, hervorragende und bahnbrechende ethische Leistung unmöglich machen.»
[ 24 ] Diese Ausführungen verbreiten Licht über jene Fragen, die eine allgemeine Ethik zu beantworten hat. Man behandelt die letztere ja vielfach so, als ob sie eine Summe von Normen sei, nach denen das menschliche Handeln sich zu richten habe. Man stellt von diesem Gesichtspunkte aus die Ethik der Naturwissenschaft und überhaupt der Wissenschaft vom Seienden gegenüber. Während nämlich die letztere uns die Gesetze von dem, was besteht, was ist, vermitteln soll, hätte uns die Ethik jene vom Seinsollenden zu lehren. Die Ethik soll ein Kodex von allen Idealen des Menschen sein, eine ausführliche Antwort auf die Frage: Was ist gut? Eine solche Wissenschaft ist aber unmöglich. Es kann keine allgemeine Antwort auf diese Frage geben. Das ethische Handeln ist ja ein Produkt dessen, was sich im Individuum geltend macht; es ist immer im einzelnen Fall gegeben, nie im allgemeinen. Es gibt keine allgemeinen Gesetze darüber, was man tun soll und was nicht. Man sehe nur ja nicht die einzelnen Rechtssatzungen verschiedener Völker als solche an. Sie sind auch nichts weiter als der Ausfluß individueller Intentionen. Was diese oder jene Persönlichkeit als sittliches Motiv empfunden hat, hat sich einem ganzen Volke mitgeteilt, ist zum «Recht dieses Volkes» geworden. Ein allgemeines Naturrecht, das für alle Menschen und alle Zeiten gelte, ist ein Unding. Rechtsanschauungen und Sittlichkeitsbegriffe kommen und gehen mit den Völkern, ja sogar mit den Individuen. Immer ist die Individualität maßgebend. Im obigen Sinne von einer Ethik zu sprechen, ist also unstatthaft. Aber es gibt andere Fragen, die in dieser Wissenschaft zu beantworten sind, Fragen, die z. T. in diesen Erörterungen kurz beleuchtet worden sind. Ich erwähne nur: die Feststellung des Unterschiedes von menschlichem Handeln und Naturwirken, die Frage nach dem Wesen des Willens und der Freiheit usw. Alle diese Einzelaufgaben lassen sich unter die eine subsumieren: Inwiefern ist der Mensch ein ethisches Wesen? Das bezweckt aber nichts anderes als die Erkenntnis der sittlichen Natur des Menschen. Es wird nicht gefragt: Was soll der Mensch tun? sondern: Was ist das, was er tut, seinem inneren Wesen nach? Und damit fällt jene Scheidewand, welche alle Wissenschaft in zwei Sphären trennt: in eine Lehre vom Seienden und eine vom Seinsollenden. Die Ethik ist ebenso wie alle anderen Wissenschaften eine Lehre vom Seienden. In dieser Hinsicht geht der einheitliche Zug durch alle Wissenschaften, daß sie von einem Gegebenen ausgehen und zu dessen Bedingungen fortschreiten. Vom menschlichen Handeln selbst aber kann es keine Wissenschaft geben; denn das ist unbedingt, produktiv, schöpferisch. Die Jurisprudenz ist keine Wissenschaft, sondern nur eine Notizensammlung jener Rechtsgewohnheiten, die einer Volksindividualität eigen sind.*
[ 25 ] Der Mensch gehört nun nicht allein sich selbst; er gehört als Glied zwei höheren Totalitäten an. Erstens ist er ein Glied seines Volkes, mit dem ihn gemeinschaftliche Sitten, ein gemeinschaftliches Kulturleben, eine Sprache und gemeinsame Anschauung vereinigen. Dann aber ist er auch ein Bürger der Geschichte, das einzelne Glied in dem großen historischen Prozesse der Menschheitsentwicklung. Durch diese doppelte Zugehörigkeit zu einem Ganzen scheint sein freies Handeln beeinträchtigt. Was er tut, scheint nicht allein ein Ausfluß seines eigenen individuellen Ichs zu sein; er erscheint bedingt durch die Gemeinsamkeiten, die er mit seinem Volke hat, seine Individualität scheint durch den Volkscharakter vernichtet. Bin ich denn dann noch frei, wenn man meine Handlungen nicht allein aus meiner, sondern wesentlich auch aus der Natur meines Volkes erklärlich findet? Handle ich da nicht deshalb so, weil mich die Natur gerade zum Gliede dieser Volksgenossenschaft gemacht hat? Und mit der zweiten Zugehörigkeit ist es nicht anders. Die Geschichte weist mir den Platz meines Wirkens an. Ich bin von der Kulturepoche abhängig, in der ich geboren bin; ich bin ein Kind meiner Zeit. Wenn man aber den Menschen zugleich als erkennendes und handelndes Wesen auffaßt, dann löst sich dieser Widerspruch. Durch sein Erkenntnisvermögen dringt der Mensch in den Charakter seiner Volksindividualität ein; es wird ihm klar, wohin seine Mitbürger steuern. Wovon er so bedingt erscheint, das überwindet er und nimmt es als vollerkannte Vorstellung in sich auf; es wird in ihm individuell und erhält ganz den persönlichen Charakter, den das Wirken aus Freiheit hat. Ebenso stellt sich die Sache mit der historischen Entwicklung, innerhalb welcher der Mensch auftritt. Er erhebt sich zur Erkenntnis der leitenden Ideen, der sittlichen Kräfte, die da walten; und dann wirken sie nicht mehr als ihn bedingende, sondern sie werden in ihm zu individuellen Triebkräften. Der Mensch muß sich eben hinaufarbeiten, damit er nicht geleitet werde, sondern sich selbst leite. Er muß sich nicht blindlings von seinem Volkscharakter führen lassen, sondern sich zur Erkenntnis desselben erheben, damit er bewußt im Sinne seines Volkes handle. Er darf sich nicht von dem Kulturfortschritte tragen lassen, sondern er muß die Ideen seiner Zeit zu seinen eigenen machen. Dazu ist vor allem notwendig, daß der Mensch seine Zeit verstehe. Dann wird er mit Freiheit ihre Aufgabe erfüllen, dann wird er mit seiner eigenen Arbeit an der rechten Stelle ansetzen. Hier haben die Geisteswissenschaften (Geschichte, Kultur- und Literaturgeschichte usw.) vermittelnd einzutreten. In den Geisteswissenschaften hat es der Mensch mit seinen eigenen Leistungen zu tun, mit den Schöpfungen der Kultur, der Literatur, mit der Kunst usw. Geistiges wird durch den Geist erfaßt. Und der Zweck der Geisteswissenschaften soll kein anderer sein, als daß der Mensch erkenne, wohin er von dem Zufalle gestellt ist; er soll erkennen, was schon geleistet ist, was ihm zu tun obliegt. Er muß durch die Geisteswissenschaften den rechten Punkt finden, um mit seiner Persönlichkeit an dem Getriebe der Welt teilzunehmen. Der Mensch muß die Geisteswelt kennen und nach dieser Erkenntnis seinen Anteil an ihr bestimmen.*
[ 26 ] Gustav Freytag sagt in der Vorrede zum ersten Bande seiner «Bilder aus der deutschen Vergangenheit» [Leipzig 1859]: «Alle großen Schöpfungen der Volkskraft, angestammte Religion, Sitte, Recht, Staatsbildung sind für uns nicht mehr die Resultate einzelner Männer, sie sind organische Schöpfungen eines hohen Lebens, welches zu jeder Zeit nur durch das Individuum zur Erscheinung kommt, und zu jeder Zeit den geistigen Gehalt der Individuen in sich zu einem mächtigen Ganzen zusammenfaßt... So darf man wohl, ohne etwas Mystisches zu sagen, von einer Volksseele sprechen. ... Aber nicht mehr bewußt, wie die Willenskraft eines Mannes, arbeitet das Leben eines Volkes. Das Freie, Verständige in der Geschichte vertritt der Mann, die Volkskraft wirkt unablässig mit dem dunklen Zwang einer Urgewalt.» Hätte Freytag dieses Leben des Volkes untersucht, so hätte er wohl gefunden, daß es sich in das Wirken einer Summe von Einzelindividuen auflöst, die jenen dunklen Zwang überwinden, das Unbewußte in ihr Bewußtsein heraufheben, und er hätte gesehen, wie das aus den individuellen Willensimpulsen, aus dem freien Handeln des Menschen hervorgeht, was er als Volksseele, als dunklen Zwang anspricht.
[ 27 ] Aber noch etwas kommt in bezug auf das Wirken des Menschen innerhalb seines Volkes in Betracht. Jede Persönlichkeit repräsentiert eine geistige Potenz, eine Summe von Kräften, die nach der Möglichkeit zu wirken suchen. Jedermann muß deshalb den Platz finden, wo sich sein Wirken in der zweckmäßigsten Weise in seinen Volksorganismus eingliedern kann. Es darf nicht dem Zufalle überlassen bleiben, ob er diesen Platz findet. Die Staatsverfassung hat keinen anderen Zweck, als dafür zu sorgen, daß jeder einen angemessenen Wirkungskreis finde. Der Staat ist die Form, in der sich der Organismus eines Volkes darlebt.
[ 28 ] Die Volkskunde und Staatswissenschaft hat die Weise zu erforschen, inwiefern die einzelne Persönlichkeit innerhalb des Staates zu einer ihr entsprechenden Geltung kommen kann. Die Verfassung muß aus dem innersten Wesen eines Volkes hervorgehen. Der Volkscharakter in einzelnen Sätzen ausgedrückt, das ist die beste Staatsverfassung. Der Staatsmann kann dem Volke keine Verfassung aufdrängen. Der Staatslenker hat die tiefen Eigentümlichkeiten seines Volkes zu erforschen und den Tendenzen, die in diesem schlummern, durch die Verfassung die ihnen entsprechende Richtung zu geben. Es kann vorkommen, daß die Mehrheit des Volkes in Bahnen einlenken will, die gegen seine eigene Natur gehen. Goethe meint, in diesem Falle habe sich der Staatsmann von der letzteren und nicht von den zufälligen Forderungen der Mehrheit leiten zu lassen; er habe die Volkheit gegen das Volk in diesem Falle zu vertreten («Sprüche in Prosa», Natw. Schr., 4. Bd., 2. Abt., S. 480f.).
[ 29 ] Hieran müssen wir noch ein Wort über die Methode der Geschichte anschließen. Die Geschichte muß stets im Auge haben, daß die Ursachen zu den historischen Ereignissen in den individuellen Absichten, Plänen usw. der Menschen zu suchen sind. Alles Ableiten der historischen Tatsachen aus Plänen, die der Geschichte zugrunde liegen, ist ein Irrtum. Es handelt sich immer nur darum, welche Ziele sich diese oder jene Persönlichkeit vorgesetzt, welche Wege sie eingeschlagen usf. Die Geschichte ist durchaus auf die Menschennatur zu gründen. Ihr Wollen, ihre Tendenzen sind zu ergründen.
[ 30 ] Wir können nun wieder das hier über die ethische Wissenschaft Gesagte durch Aussprüche Goethes belegen. Wenn er sagt: «Die vernünftige Welt ist als ein großes unsterbliches Individuum zu betrachten, das unaufhaltsam das Notwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das Zufällige zum Herrn macht», [«Sprüche in Prosa», ebenda S. 482], so ist das nur aus dem Verhältnisse, in dem wir den Menschen mit der Geschichtsentwicklung erblicken, zu erklären. - Der Hinweis auf ein positives individuelles Substrat des Wirkens liegt in den Worten: «Unbedingte Tätigkeit, von welcher Art sie sei, macht zuletzt bankerott» (Ebenda S. 463). Dasselbe in: «Der geringste Mensch kann komplett sein, wenn er sich innerhalb der Grenzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewegt.» (Ebenda S. 443) -Die Notwendigkeit, daß der Mensch sich zu den leitenden Ideen seines Volkes und seiner Zeit erhebe, ist ausgesprochen in (ebenda S. 487): «Frage sich doch jeder, mit welchem Organ er allenfalls in seine Zeit einwirken kann und wird», und (ebenda S. 455): «Man muß wissen, wo man steht und wohin die andern wollen.» Unsere Ansicht von der Pflicht ist wiederzuerkennen in (ebenda S. 460): «Pflicht, wo man liebt, was man sich selbst befiehlt.»
[ 31 ] Wir haben den Menschen als erkennendes und handelndes Wesen durchaus auf sich selbst gestellt. Wir haben seine Ideenwelt als mit dem Weltengrunde zusammenfallend bezeichnet und haben erkannt, daß alles, was er tut, nur als der Ausfluß seiner eigenen Individualität anzusehen ist. Wir suchen den Kern des Daseins in dem Menschen selbst. Ihm offenbart niemand eine dogmatische Wahrheit, ihn treibt niemand beim Handeln. Er ist sich selbst genug. Er muß alles durch sich selbst, nichts durch ein anderes Wesen sein. Er muß alles aus sich selbst schöpfen. Also auch den Quell für seine Glückseligkeit. Wir haben ja erkannt, daß von einer Macht, die den Menschen lenkte, die sein Dasein nach Richtung und Inhalt bestimmte, ihn zur Unfreiheit verdammte, nicht die Rede sein kann. Soll dem Menschen daher Glückseligkeit werden, so kann das nur durch ihn selbst geschehen. So wenig eine äußere Macht uns die Normen unseres Handelns vorschreibt, so wenig wird eine solche den Dingen die Fähigkeit erteilen, daß sie in uns das Gefühl der Befriedigung erwecken, wenn wir es nicht selbst tun. Lust und Unlust sind für den Menschen nur da, wenn er selbst zuerst den Gegenständen das Vermögen beilegt, diese Gefühle in ihm wachzurufen. Ein Schöpfer, der von außen bestimmte, was uns Lust, was Unlust machen soll, führte uns am Gängelbande.*
[ 32 ] Damit ist jeder Optimismus und Pessimismus widerlegt. Der Optimismus nimmt an, daß die Welt vollkommen sei, daß sie für den Menschen der Quell höchster Zufriedenheit sein müsse. Sollte das aber der Fall sein, so müßte der Mensch erst in sich jene Bedürfnisse entwickeln, wodurch ihm diese Zufriedenheit wird. Er müßte den Gegenständen das abgewinnen, wonach er verlangt. Der Pessimismus glaubt, die Einrichtung der Welt sei eine solche, daß sie den Menschen ewig unbefriedigt lasse, daß er nie glücklich sein könne. Welch ein erbarmungswürdiges Geschöpf wäre der Mensch, wenn ihm die Natur von außen Befriedigung böte! Alles Wehklagen über ein Dasein, das uns nicht befriedigt, über diese harte Welt muß schwinden gegenüber dem Gedanken, daß uns keine Macht der Welt befriedigen könnte, wenn wir ihr nicht zuerst selbst jene Zauberkraft verliehen, durch die sie uns erhebt, erfreut. Befriedigung muß uns aus dem werden, wozu wir die Dinge machen, aus unseren eigenen Schöpfungen. Nur das ist freier Wesen würdig.

